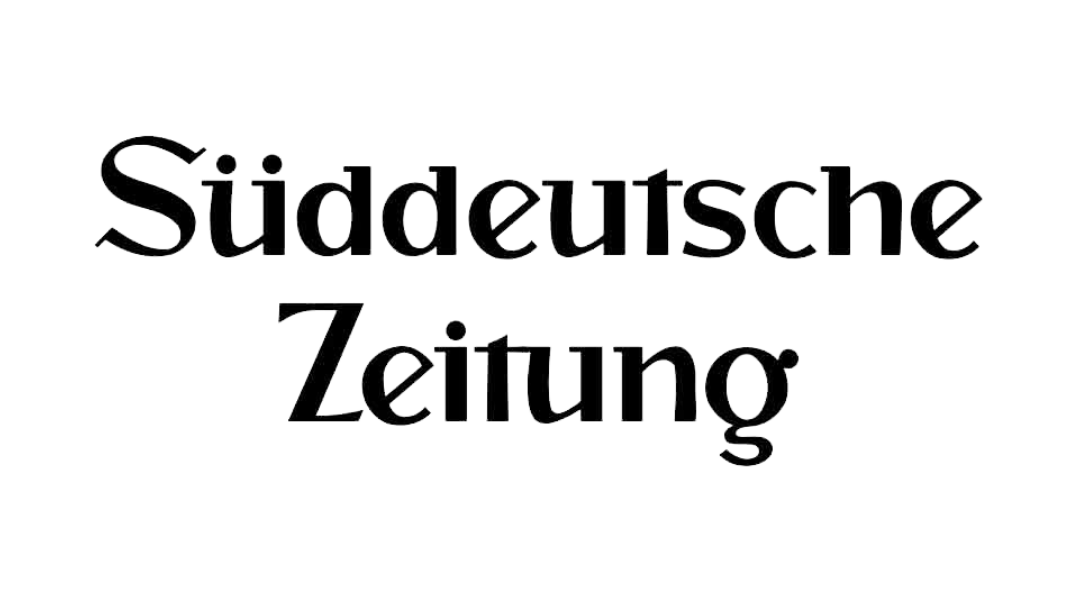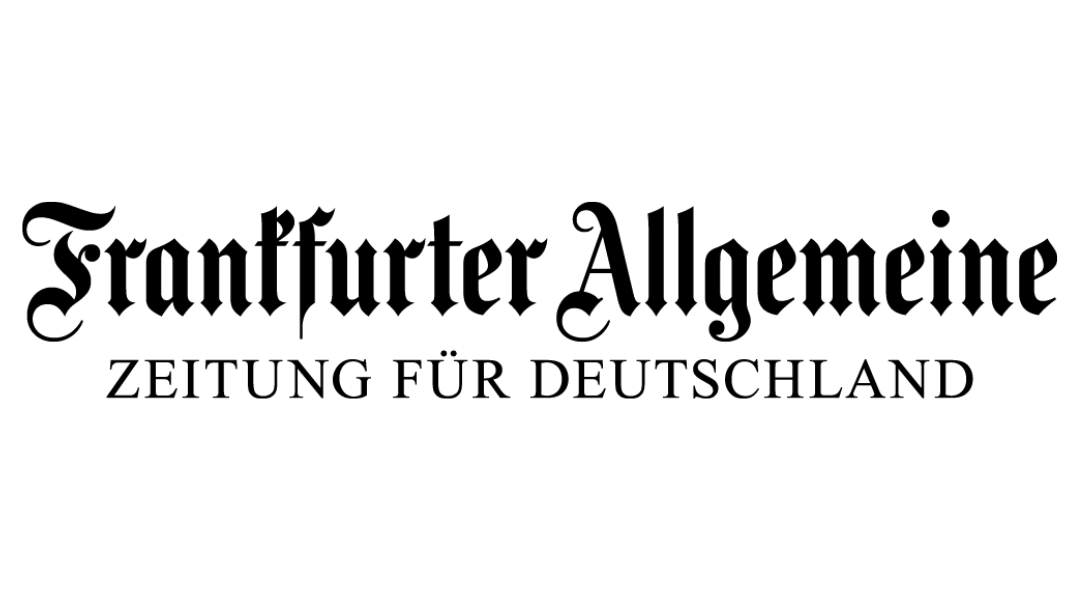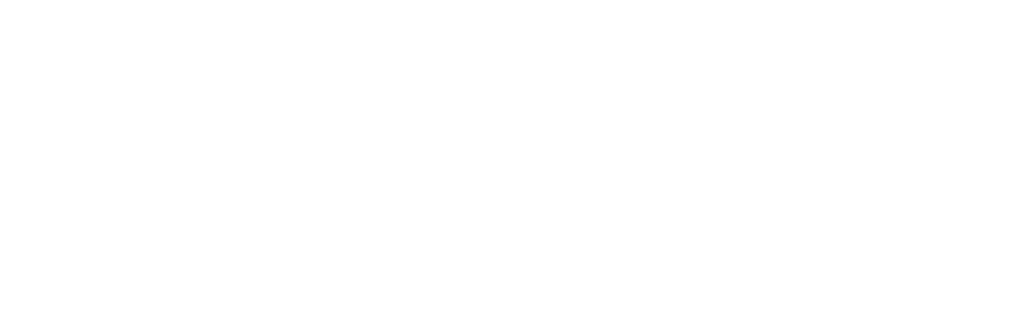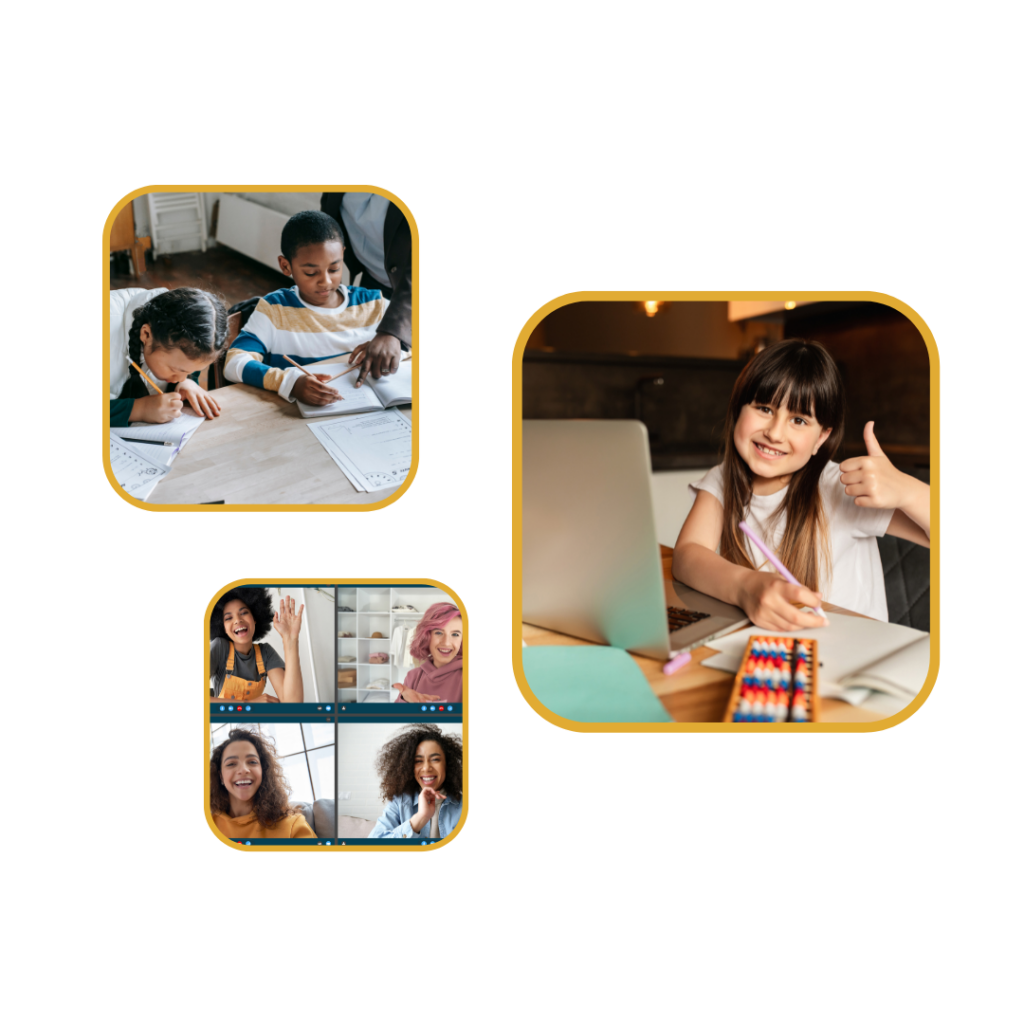
Der VNN Bundesverband Nachhilfe- und Nachmittagsschulen e. V. setzt sich für Qualität, Transparenz, Zuverlässigkeit und Kompetenz in der Nachhilfebranche ein.
Als Bundesverband vertritt der VNN die Interessen der institutionellen Nachhilfe. Er ist ein Partner der Politik, der Schulen und Lehrkräfte.
Nachhilfe ist ein fester Bestandteil des Bildungssystems. Wir setzen uns dafür ein, dass sie ein kompetenter und zuverlässiger Partner für alle Akteure in der Bildung ist.
Patrick Nadler, VNN-Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer

Wir setzen uns für unsere Mitglieder ein und engagieren uns mit unseren Partnern.
0
Nachhilfestandorte
0
Lernende
0
Lehrkräfte





Mitglied werden
- Vernetzung und kollegialer Austausch
- Wertvolle Informationen für die tägliche Arbeit
- Akzeptanz der Nachhilfe in Gesellschaft und Politik
Wir bieten unseren Mitgliedern vielfältige Leistungen.